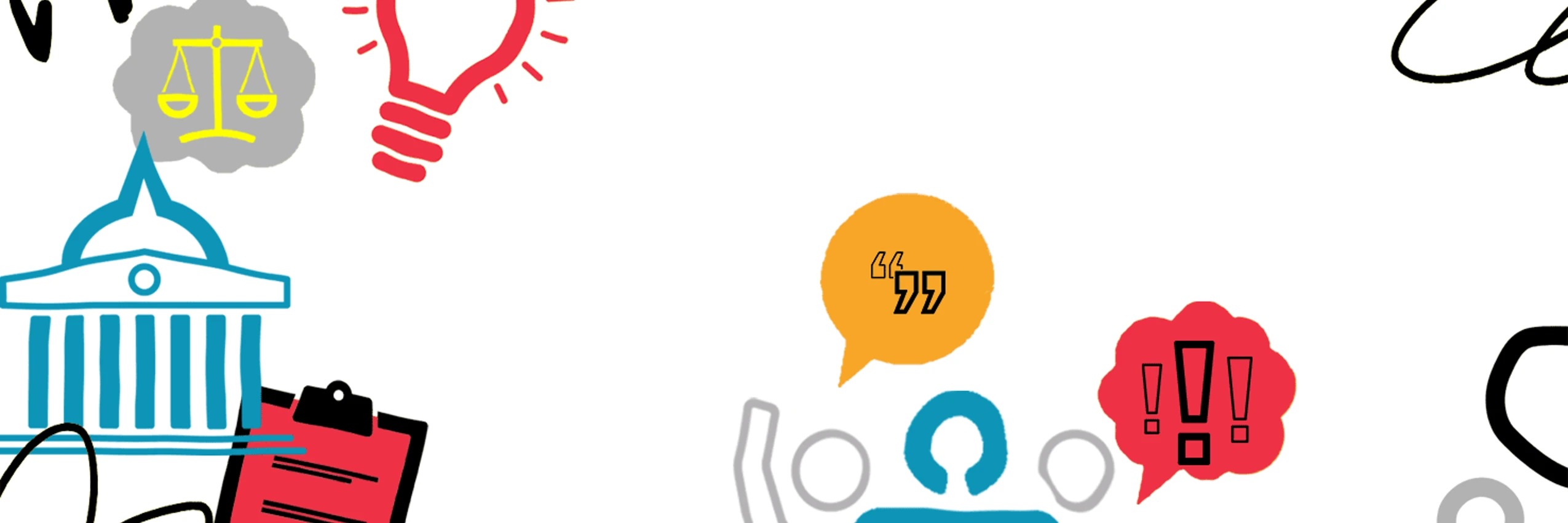
Amnesty Zwischenbericht: Wie sich die Bekämpfung der Corona-Pandemie auf Menschenrechte in Österreich auswirkt
16. April 2020Die COVID-19 Pandemie stellt eine beispiellose Bedrohung dar, mit Auswirkungen auf alle Aspekte unseres Lebens und unvorhersehbaren Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Daher besteht auch eine umfassende Bedrohung aller unserer Menschenrechte. Amnesty International Österreich beobachtet, dokumentiert und analysiert die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Österreich und gibt einen Überblick über die aktuell betroffenen Menschenrechte. Dies stellt eine erste, nicht abschließende Bestandsaufnahme dar. Dafür haben wir Gesetze und Verordnungen analysiert und Berichte aus Medien und von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sowie Beschwerden, die in den letzten Wochen an Amnesty International herangetragen wurden, berücksichtigt.
Damit möchten wir:
- Von den verantwortlichen Akteur*innen einen menschenrechtsbasierten Ansatz zur Krisenbewältigung einfordern, der Transparenz sicherstellt, auf besonders schutzbedürftige Personen achtet und Menschen befähigt, ihre Rechte einzufordern.
- Menschenrechtliche Risiken frühzeitig erkennen.
- Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, um Rechenschaftspflicht sicherzustellen, zukünftigen Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen und gemeinsam aus der Krise zu lernen.

Staatliche Schutz-und Achtungspflichten
Amnesty International untersucht die Auswirkungen der Krise auf bürgerliche, politische sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Menschenrechte sind universell, unteilbar, voneinander abhängig und miteinander verbunden – wie uns die Krise derzeit deutlich zeigt – und beinhalten Schutz- sowie Achtungspflichten.
Der Staat ist zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie verpflichtet und muss unser Recht auf Leben, Gesundheit sowie andere Menschenrechte schützen und gewährleisten. Dafür müssen angemessene und erforderliche Maßnahmen getroffen werden.
Für diese Einschätzung spielt es eine Rolle, welche Informationen der Staat hinsichtlich der Gefährdung hat oder haben müsste, welche Kapazitäten zum Schutz zu Verfügung stehen, und ob die notwendige Sorgfalt angewandt wird, um eine Verletzung zu vermeiden.Zudem muss der Staat unsere Menschenrechte achten und jeder Eingriff muss gerechtfertigt sein. Dafür müssen die Maßnahmen zunächst klar rechtlich geregelt sein. Alle Menschen müssen wissen, was sie dürfen und was nicht. Sie müssen sich auf die bestehenden Gesetze verlassen und vorhersehen können, welche rechtlichen Folgen das eigene Handeln hat.
Grundsätzlich können Menschenrechtseingriffe daher nicht per Erlass (einer allgemeinen Weisung gegenüber Verwaltungsorganen) geregelt werden, sondern müssen immer auf eine gesetzliche Ermächtigung gestützt sein. So kritisierten auch Verwaltungsrichter in einer gemeinsamen Erklärung, dass bloße Erlässe kein zulässiges Mittel für Grundrechtseingriffe gegenüber Bürger*innen darstellen. Zudem müssen die Maßnahmen – nach wissenschaftlichen Erkenntnissen – geeignet und notwendig sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Das heißt, ein Eingriff darf nicht über das für die Umstände erforderliche Maß, das zum Erreichen des Ziels (Schutz der öffentlichen Gesundheit) erforderlich ist, hinausgehen. Es ist das gelindeste, am wenigsten beeinträchtigende, wirksame Mittel zu wählen.
Darüber hinaus müssen die Maßnahmen auch verhältnismäßigsein. Dies erfordert eine Abwägung zwischen dem zu erwarteten Ergebnis der Maßnahme und dem Eingriff in die Menschenrechte. Schließlich dürfen die Maßnahmen weder diskriminierend sein, noch sich diskriminierend auswirken.
Ein menschenrechtsbasierter Ansatz
Menschenrechte müssen im Mittelpunkt aller Bemühungen um Prävention, Eindämmung und Behandlung des Coronavirus stehen.Während dem Staat bei der Eindämmung der COVID-19 Pandemie ein gewisser Ermessenspielraum zukommt, muss die Regierung ihre Überlegungen und Strategien offenlegen und für alle zugänglich kommunizieren. Menschen in Österreich haben den Anspruch auf Rechtssicherheit, auf wirksamkeitsorientierte und evidenz-basierte Entscheidungen und auf eine sorgfältige Abwägung von Alternativen zu Eingriffen in unsere Menschenrechte.
Gerade in Zeiten großer Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit ist größtmögliche Transparenzüber öffentliche Entscheidungen wesentlich -nicht nur aufgrund der Prinzipien eines Rechtsstaates und einer Demokratie -sondern auch, um das Vertrauen in den Staat zu erhalten. Während die COVID-19 Pandemie und die Maßnahmen zur Bekämpfung eine Bedrohungfür unser aller Menschenrechte darstellt, sind manche Menschen davon mehr betroffen als andere.
Daher ist es jetzt wichtig, auf die besonders schutzbedürftigen Personen zu achten (z.B. Risikogruppen, wohnungslose Menschen, Menschen mit Behinderungen etc.) und aktive Maßnahmen zu treffen, um deren Schutz zu garantieren.Zudem müssen Menschenrechtverletzungen auch in Krisenzeiten Konsequenzen haben. In einer Zeit besonders intensiver Eingriffe, müssen wirksame Beschwerdemöglichkeiten erhalten bleiben, behördliches Fehlverhalten unabhängig untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Aus all diesen Gründen ist es jetzt besonders wichtig, staatliches Handeln zu beobachten, zu dokumentieren und zu analysieren.
Erste menschenrechtliche Einschätzungen
Gerade in den ersten Wochen waren drastische Maßnahmen wohl notwendig, um eine rasante Verbreitung des Coronavirus wie in anderen Ländern zu vermeiden. Ein Monat nach der Verabschiedung des ersten Covid19-Gesetzes zeigen die Bemühungen Erfolg und es gibt neue Erkenntnisse zu wirksamen Schutzmöglichkeiten.Das heißt auch, das Gesetze und Verordnungen, die vor einem Monat noch gerechtfertigt waren, es jetzt vielleicht nicht mehr sind. Mit jedem Tag steigt die Begründungspflicht für die umfassenden und tiefgreifenden Eingriffe in unsere Menschenrechte. Daher ist es auch wichtig, dass alle Gesetze und Verordnungen ein Ablaufdatum (sogenannte „sunset clause“) haben und die Eingriffe schrittweise, je nach Entwicklung der Ausbreitung des Virus, wieder zurückgenommen werden. Zentral ist, dass die Eindämmung der COVID-19 Pandemie den Rechtsstaat nicht unterminieren darf. Bei den Diskussionen um die staatlichen Maßnahmen geht es also darum, dass jeder Eingriff in unsere Menschenrechte klar rechtlich geregelt, notwendig und verhältnismäßig sein muss. Zudem muss jetzt auf die besonders Schutzbedürftigen geachtet werden. Vor diesem Hintergrund haben wir einige Probleme und Spielraum für Verbesserungen identifiziert. Wie erwähnt, soll diese Analyse nur als erster Schritt verstanden werden.



